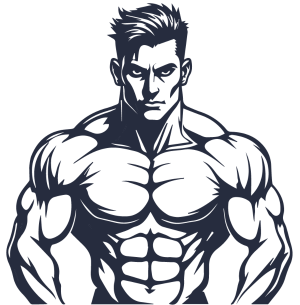Während körperliche Fitness allgemein als positiv angesehen wird, existiert eine Schattenseite des Trainings: die sogenannte Muskel- oder Fitnesssucht. Sie beschreibt ein zwanghaftes Verhalten, bei dem Training und Körperoptimierung zwanghafte Züge annehmen und das gesamte Leben dominieren.
Definition und Symptome
Muskel- oder Fitnesssucht wird in der Psychologie als Sonderform der Körperdysmorphophobie betrachtet. Betroffene nehmen sich trotz überdurchschnittlicher Muskelmasse als „zu dünn“ oder „nicht fit genug“ wahr. Typische Merkmale sind:
- Exzessives Training trotz Schmerzen oder Verletzungen
- Vernachlässigung sozialer Kontakte
- Strikte Diäten oder Supplementierung ohne medizinische Indikation
- Panik bei Trainingsausfällen
Diese Verhaltensweisen ähneln jenen von substanzbezogenen Abhängigkeiten und können langfristig gesundheitsschädlich sein.
Ursachen und Risikofaktoren
Die Ursachen sind vielfältig: Geringes Selbstwertgefühl, gesellschaftlicher Druck, mediale Ideale oder traumatische Erfahrungen können Auslöser sein. Besonders gefährdet sind junge Männer, die in sozialen Medien ständig mit Körperbildern konfrontiert werden.
Auch in der Fitnesskultur selbst wird extreme Disziplin oft als Stärke glorifiziert. Dies erschwert eine frühe Diagnose und führt dazu, dass viele Betroffene lange Zeit unbemerkt bleiben.
Therapieansätze und Prävention
Die Behandlung erfolgt meist im Rahmen einer psychotherapeutischen Betreuung. Ziel ist es, ein gesundes Körperbild und realistische Erwartungen zu fördern. Auch Gruppentherapien und sportpsychologische Beratung zeigen gute Erfolge.
Präventiv wirken Aufklärung, medienkritischer Umgang und ein differenzierter Blick auf Trainingsziele. Fitnessstudios, Trainer und Influencer tragen Verantwortung, einen realistischen Umgang mit Körperidealen zu fördern.